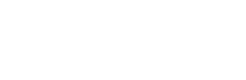Arbeitsrecht für Startups – was Gründer:innen wissen sollten
Rechtliche Klarheit für Gründer:innen – Ein Gespräch über Arbeitsrecht im Startup-Alltag. Als Mitglied unseres Expertenrats berät unsere langjährige Partnerkanzlei Sonntag & Partner Gründer:innen in Rechts- und Steuerfragen.
Im Interview geben die Fachanwälte Kerstin Ducke und Viktor Stepien praxisnahe Einblicke, worauf Startups beim Thema Arbeitsrecht achten sollten – von Werkstudentenverträgen bis hin zu Kündigungen und Freelancer-Regelungen. Viel Spaß beim Lesen!


Kerstin Ducke Viktor Stepien
(Bildquelle: Sonntag)
Frage 1: Muss ich auch als Gründer:in bei der Einstellung von Mitarbeitenden die Vorschriften des Arbeitsrechts beachten?
Kerstin Ducke: Wir hören häufig Sätze wie „ich bin doch nur ein kleines Startup – das kann doch alles gar nicht für mich gelten.“ Leider ist das so nicht richtig. Sobald auch nur ein Mitarbeitender eingestellt wird, gelten bereits eine Vielzahl arbeitsrechtlicher Vorschriften.
Viktor Stepien: Arbeitgeber sollten das Arbeitsrecht als Schutzrecht der Arbeitnehmenden nicht nur negativ betrachten. Klare Spielregeln können einem jungen Unternehmen vielmehr helfen, teure oder rechtlich heikle Situationen von vornherein zu verhindern. Zugleich kann die explizite Anerkennung arbeitsrechtlicher Vorschriften dazu genutzt werden, den eigenen Wertekodex des Unternehmens positiv hervorzuheben und sich damit als attraktiver Arbeitgeber am Markt zu positionieren.
Muss ich als Gründer:in Arbeitsverträge unbedingt schriftlich abschließen – auch wenn ich nur Werkstudierende oder Personen auf Minijob-Basis beschäftige?
Viktor Stepien: In Deutschland müssen Arbeitsverträge nicht zwingend schriftlich abgeschlossen werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen ein schriftlicher Abschluss zwingend ist, wie beispielweise bei Be-fristungsabreden. Darüber hinaus besteht eine gesetzliche Verpflichtung für Arbeitgeber, die wichtigsten Basics eines Arbeitsvertrags jedenfalls in Textform nachzuweisen. Hierzu gehören u.a. das Gehalt, die wöchentliche Arbeitszeit, der Arbeitsort oder wie viel Urlaub es geben soll. Fehlt dieser Nachweis, bleibt der Vertrag zwar wirksam, dem Arbeitgeber können aber Bußgelder drohen.
Kerstin Ducke: Richtig. In der Praxis bietet es sich daher nach wie vor unbedingt an, die Vertragsinhalte zu dokumentieren – letztlich auch aus Gründen der Beweisbarkeit, falls es doch einmal zu Streit kommt. Solange es dabei nicht um befristete Verträge geht, spricht nichts dagegen, den Vertrag als Scan zwischen den Parteien auszutauschen oder moderne (elektronische) Signaturvarianten zu verwenden.
Haben "Werkis" und Minijobber eigentlich dieselben Rechte wie Vollzeitkräfte oder gelten da andere Regeln?
Kerstin Ducke: Viele glauben, dass für Werkstudierende oder Minijobber andere arbeitsrechtliche Regeln gelten - ein weitverbreiteter Irrtum. Beides sind ganz normal Arbeitnehmende, mit denselben arbeitsrechtlichen Rechten und Pflichten. Besonderheiten gibt es indes bei der Steuer- und den Sozialabgaben.
Viktor Stepien: Genau, Privilegierungen bei Steuern und Sozialabgaben machen diese Beschäftigungsformen natürlich für junge Unternehmen interessant. Auf der anderen Seite ist gerade aufgrund dieser Vorzüge bei der Vertragsgestaltung und Umsetzung des Arbeitsverhältnisses besondere Sorgfalt geboten. Fehler in der Rechtsanwendung können dazu führen können, dass die Privilegierungen nicht greifen und folglich Nachzahlungen drohen können.
Muss ich Überstunden meiner Mitarbeitenden immer auszahlen oder geht das auch anders?
Kerstin Ducke: Im Grundsatz gilt, dass Überstunden entweder zu vergüten sind oder das Zeitguthaben durch Freizeit auszugleichen ist. In bestimmten Fällen und Grenzen kann vertraglich vereinbart werden, dass etwa ein Teil der Überstunden mit der Vergütung abgegolten wird. Unabhängig davon ist es bereits häufig ein Streitpunkt, ob Überstunden tatsächlich geleistet und durch den Arbeitgeber angeordnet, gebilligt oder ge-duldet wurden. Denn auf der anderen Seite ist es auch nicht zulässig, dass Arbeitnehmende eine über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende Leistung aufdrängen, um dann Überstundenvergütung zu fordern.
Was muss ich als Gründer:in bei einer Kündigung beachten und welchen rechtlichen Risiken setze ich mich dabei aus?
Viktor Stepien: Kündigungen sind immer – auch und gerade in noch jungen Unternehmen – ein sehr sensibles Thema, sowohl rechtlich als auch menschlich. Zugleich gilt, dass Fehler bei der Umsetzung einer Kündigung für das Unternehmen sehr schnell teuer werden können, da die Positionen der Beteiligten regelmäßig diametral entgegenstehen. Da es bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses zudem um die soziale Absicherung des Arbeitnehmenden gehen kann, sind die formellen wie materiellen Anforderungen an eine Kündigung in Deutschland sehr hoch – entsprechend schnell können Fehler passieren. Dies beginnt beispielsweise damit, dass die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses stets schriftlich erfolgen muss: Es muss also ein Papierdokument an den Arbeitnehmenden übergeben werden, welches die Originalunterschrift des Arbeitgebers trägt. Eine E-Mail oder Whatsapp-Nachricht reicht nicht aus!
Kerstin Ducke: Daneben müssen auch in jungen und kleinen Unternehmen Kündigungsfristen eingehalten werden. Bei der Kündigung von besonderen Personengruppen wie z.B. Schwangeren oder schwerbehinderten Mitarbeitenden kann es auch einen besonderen Kündigungsschutz geben. Sobald das Unternehmen zudem mehr als zehn vollzeitäquivalente Mitarbeitende im Betrieb beschäftigt, greift grundsätzlich das allgemeine Kündigungsschutzgesetz ein. Dann ist eine Kündigung nur noch möglich, wenn ein verhaltensbedingter, personenbedingter oder betriebsbedingter Grund vorliegt.
Kann die Beschäftigung von Freelancern eine Alternative sein oder gibt es dabei versteckte Risiken, die ich kennen sollte?
Kerstin Ducke: Der Einsatz freier Mitarbeitender kann im Einzelfall natürlich eine attraktive Alternative sein, da Freelancer in diesem Sinne nicht arbeitnehmend sind und damit die Schutzvorschriften des Arbeitsrechts für diese Personen im Grundsatz nicht gelten. Jedoch ist besondere Vorsicht geboten, um das Risiko einer sogenannten Schein-Selbstständigkeit auszuschließen.
Viktor Stepien: Unter dem Begriff der Schein-Selbstständigkeit versteht man eine Situation, in der eine Person nur vermeintlich als Freelancer:in beauftragt wird, tatsächlich aber wie ein Arbeitnehmender behandelt wird. Wichtig ist dabei zunächst, dass Freelancer nicht schon dadurch zu Freelancern werden, weil die Vertragsparteien dies so vereinbaren. Bewertet wird vielmehr die tatsächliche Vertragsdurchführung, womit es immer auf die konkrete Situation ankommt. Das macht die Abgrenzung gerade in der Praxis schwierig. Auf der anderen Seite sind die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Einordnung als Freelancer:in für gerade junge Unternehmen gravierend, da erhebliche Nachzahlungen insbesondere hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie sogar strafrechtliche Folgen drohen können. Jeder Einsatz von Freelancern muss daher exakt vorbereitet werden.
Du möchtest noch tiefer in arbeitsrechtliche Fragen einsteigen oder hast konkrete Anliegen aus deinem Gründungsalltag?
Dann nutze die Gelegenheit und komm am 23. September 2025 zur Startup Lounge im DZ.S – mit Impulsen, Austausch und der Möglichkeit, deine Fragen direkt an unsere Expert:innen Kerstin und Viktor zu richten.
Zur Anmeldung.
Sonntag & Partner – Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung
Mit über 300 Mitarbeitenden gehört Sonntag & Partner zu den führenden interdisziplinären Kanzleien im süddeutschen Raum. Der Fokus: individuelle Beratung von Startups, Mittelstand und Großunternehmen – stets mit Blick für das Ganze.
Übrigens: Sonntag & Partner ist Teil unseres Expertenrats – deinem Zugang zu fundierter Beratung rund um Recht, Steuern und Unternehmensstruktur.